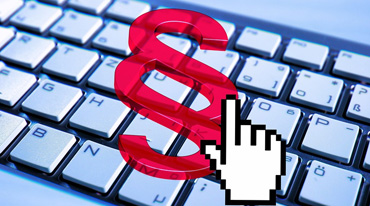Die ehemalige Landesirrenanstalt Domjüch bei Strelitz-Alt
Denkmal des Monats Mai 2012
Die allmähliche Anerkennung psychischer Erkrankungen als Krankheit führte im 19. Jahrhundert zur Trennung der Geisteskranken von den Verbrechern und begründete die Errichtung sogenannter Irrenanstalten. Während der Schweriner Landtag bereits 1821 über die Errichtung einer Irrenheilanstalt beriet und diese schon 1830 auf dem Sachsenberg bei Schwerin ihren Betrieb aufnahm – es war die erste als eigene Irrenanstalt erbaute Einrichtung in Deutschland – zog der Großherzog von Mecklenburg-Strelitz erst 1863 die Trennung von Irrenhaus und Zuchthaus in Betracht. So kam es zunächst 1889 zum Bau eines eigenen Gebäudes für Geisteskranke innerhalb der Strafanstalt. Doch schon im Folgejahr 1890 wurde eine Kommission ins Leben gerufen, die die Lage und Gestalt eines Neubaus beraten sollte, was schließlich 1899 den Bau der großzügigen Anlage außerhalb des Stadtgebietes von Neustrelitz und Strelitz-Alt am Domjüchsee zum Ergebnis hatte (Abb. 1). Auf Anraten des leitenden Arztes wurde die Strelitzer Anstalt nach dem Vorbild der Pflege- und Heilanstalt Gehlsdorf bei Rostock (seit 1886) als großzügige Anlage im Pavillonsystem angelegt. So entstanden bis 1902 das Verwaltungsgebäude (Abb. 2) unmittelbar am Seeufer und in seiner Achse das Küchengebäude (Abb. 3), nach Westen folgend der Wasserturm mit angebautem Kessel- und Maschinenhaus und das Landwirtschaftsgebäude mit Sektionszimmer und Leichenaufbahrraum. Links und rechts dieser Gebäudeachse wurden vier Krankenhäuser zur Unterbringung von maximal 180 Patienten errichtet, nach Männern und Frauen sowie Leicht- und Schwerkranken getrennt. Jedes dieser vier Patientenhäuser wiederum gliederte sich in drei Säle, den Aufenthalts-, den Wach- und den Schlafsaal; außerdem besaß jedes Haus zwei Isolierzellen. Die einzelnen Häuser waren über unterirdische Gänge für die Versorgungsleitungen miteinander verbunden. Zugehörig zum Komplex waren landwirtschaftliche Flächen von 12 Hektar Größe, die für den Eigenbedarf bewirtschaftet wurden, und ein kleiner Friedhof.
1939 wurde Domjüch für viele Kranke zur Durchgangsstation, unter anderem auf dem Weg nach Schwerin (Sachsenberg), was für viele das Todesurteil bedeutete. Bereits 1943 wurde Domjüch zu einem Tuberkulose-Krankenhaus umgewandelt und mit dem Einmarsch der Roten Armee übernahmen die sowjetischen Truppen die Anlage bis 1989/90. Nach Bereinigung des Geländes von militärischen Hinterlassenschaften und Abbruch der nach 1945 errichteten Unterkunftsgebäude stand die Liegenschaft zum Verkauf. Eine erste Privatisierung 2005/06 scheiterte schließlich, so dass es Ende 2009 zu einem erneuten Eigentümerwechsel kam. Dank der Unterstützung durch einen zugleich gegründeten Förderverein gelang es endlich, den weiteren Verfall zu stoppen. Durch den Verkauf der Teilfläche des historischen Areals, die ursprünglich als Wirtschaftshof und Gartenland der Anstalt zur Versorgung der Bewohner diente und nun von den Stadtwerken für 25 Jahre mit einer Photovoltaik-Anlage bestückt wurde, konnte ein Grundkapital für notwendige Untersuchungs- und Erschließungsmaßnahmen geschaffen werden.
Der Gebäudekomplex mit seinen zentralen sieben Gebäuden ist von hoher landesgeschichtlicher und architekturhistorischer, volkskundlicher und wissenschaftlicher Bedeutung, denn anders als in Gehlsdorf bei Rostock, Stralsund und Ueckermünde, wo zu etwa gleicher Zeit ebenfalls umfangreiche Gebäudekomplexes gleicher Funktion entstanden, die aber nach wie vor als Krankenhäuser genutzt werden und infolgedessen zahlreiche Veränderungen und Verluste erfahren mussten, sind hier alle Gebäude erhalten und weisen ihre ursprünglichen Raumstrukturen nahezu unverändert auf. Insofern besteht das denkmalpflegerische Interesse vor allem am Erhalt des Gebäudeensembles, wobei der Verwaltungsbau mit der Kapelle (Abb. 4) und die beiden anschließenden Krankenhäuser wegen ihrer landschaftsprägenden Anordnung am Seeufer Priorität genießen. An der Sicherung des zentralen Wirtschaftsgebäudes mit seiner bemerkenswerten Fassadengestaltung besteht ebenfalls ein vordringliches Interesse, denn dieser in funktionaler und künstlerischer Hinsicht wesentliche Bestandteil des ehemaligen Krankenhauskomplexes konnte bei den vergleichbaren und bereits umfassend instandgesetzten Anlagen in Gehlsdorf und Ueckermünde leider nicht umgenutzt und bewahrt werden.
Mit Unterstützung aus dem Landesprogramm zur Erhaltung von Denkmalen in Mecklenburg-Vorpommern gelang es schon 2010, die Dächer aller zur Kernanlage gehörenden Gebäude zu sichern. Als Lieferant historischer Dachziegel und anderer Baumaterialien dient dabei der etwas jüngere Erweiterungsbau, der 1909/10 im Nordosten des Komplexes errichtet worden war und dessen Erhaltung als materielles Zeugnis wegen des Verlusts des halben Daches und weiterer Schäden nachrangig beurteilt wird. Außerdem gelang es, die an das Verwaltungsgebäude angebaute Kapelle zu reparieren (Abb. 5), deren Dach bei einem Sturm Mitte der 1990er Jahre durch einen Baum stark geschädigt worden war. Trotz des erheblichen Schadens und langen Leerstands war der Kapellenraum erhalten geblieben und konnte in Zusammenhang mit den ersten Sicherungsmaßnahmen restauriert werden. Seitdem präsentiert die Kapelle exemplarisch die Qualität der ursprünglichen Architektur, die von hellen, nach der jeweiligen Gebäudefunktion differenzierten Putzfassaden und steilen Krüppelwalmdächern mit glasierten Doppelmuldenfalzziegeln geprägt wurde. Mit der Restaurierung der hölzernen Tonne über dem Kapellenraum, der freistehenden Holzstützen und der Wiederherstellung des Wandpaneels, der Eisengussfenster und Eingangstür (Abb. 6) vermittelt sie nun auch einen Eindruck der Innenausstattung, die in allen übrigen Gebäuden im Laufe der 20 Jahre Leerstand verloren gegangen ist. Am 27.Mai 2011 konnte die Kapelle mit einem Festgottesdienst feierlich wieder eröffnet werden. Des Weiteren wurde beim Maschinenhaus, dessen historische Heizkessel noch erhalten sind, die Dachdeckung abgenommen, um den stark einsturzgefährdeten Dachstuhl zu entlasten und am Gebäude weitere Arbeiten ausführen zu können.
In den letzten beiden Jahren wurde endlich der historische Bestand der umgebenden Parkanlage herausgearbeitet, indem der jüngere Aufwuchs entfernt und Blickachsen, insbesondere vom Verwaltungsgebäude auf den Domjüchsee, geschaffen wurden. Auch die historischen Hecken und Alleen, so vor allem die Pyramideneichen-Allee entlang des Haupterschließungsweges, übernehmen nun wieder die Strukturierung der historischen Anlage (Abb. 7).
Das große Engagement des "Vereins zum Erhalt der Domjüch – ehemalige Landesirrenanstalt e.V." sorgt nicht nur dafür, dass bei den zahlreichen Arbeitseinsätzen auf dem Gelände viele Freiwillige helfen, sondern auch für die lebendige Auseinandersetzung mit der Geschichte der ehemaligen Landesirrenanstalt und späteren Heil- und Pflegeanstalt. Dank der Öffnung des Geländes und saisonaler Führungen wird der Komplex nach Jahrzehnten der Nichtbeachtung von der Bevölkerung wieder wahrgenommen, und ein lokaler Aktionsplan im Rahmen des Bundesprogramms "Toleranz fördern – Kompetenz stärken" führt auch Jugendliche an dieses materielle Zeugnis der jüngeren Geschichte heran.
Infolge der Aufarbeitung der Fenster und Türen im ehemaligen Stationsgebäude für schwer erkrankte Frauen (Abb. 8–9) wurde jetzt ein nutzbarer Innenraum hergestellt, der ab dem 9. Juni 2012 Heimstätte der ersten Kulturtage auf der Domjüch sein wird und einen ersten Schritt auf dem Weg der Konzeptfindung für die zukünftige Nutzung des Gebäudekomplexes darstellen kann. Vielleicht entwickeln sich während der am 29. April startenden Saison 2012 weitere Ideen für touristisch-kulturelle Nutzungen, die sich in den historischen Kontext der Anlage einfügen.
Dr. Bettina Gnekow
Denkmal des Monats Mai 2012
Die ehemalige Landesirrenanstalt Domjüch bei Strelitz-Alt

Abb. 1: Gesamtansicht von Westen
LAKD

Abb. 2: Verwaltungsgebäude, Hauptansicht, Ansicht von Süden
LAKD

Abb. 3: Wirtschaftsgebäude, Ansicht von Westen
LAKD

Abb. 4: Verwaltungsgebäude mit Kapellenanbau, Ansicht von Westen
LAKD

Abb. 5: Verwaltungsgebäude mit Kapellenanbau, Ansicht von Norden
LAKD

Abb. 6: Kapelleninnenraum
LAKD

Abb. 7: Letzte Arbeiten der Baumfällmaßnahmen vor der Nordwestfassade des Stationsgebäudes für leicht erkrankte Frauen
LAKD

Abb. 8: Stationsgebäude für schwer erkrankte Frauen, Ansicht von Norden
LAKD

Abb. 9: Stationsgebäude für schwer erkrankte Frauen, Ansicht von Westen
LAKD