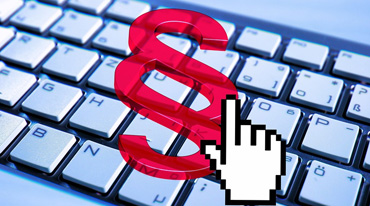Schlossanlage Ivenack im Fokus
Denkmal des Monats Juli 2013


Abb. 1: Ivenack, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte, Messtischblatt, Detail, 1880
Quelle: LAKD-MV/LD
Abb. 1: Ivenack, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte, Messtischblatt, Detail, 1880
Quelle: LAKD-MV/LD
Die östlich von Stavenhagen gelegene Gutsanlage in Ivenack, landläufig als Schlossanlage bezeichnet, ist überregional bekannt durch die tausendjährigen Eichen im ehemaligen Tiergarten. Die reizvoll am Ivenacker See gelegene Anlage um das barocke Herrenhaus schien in einen Dornröschenschlaf versunken zu sein.
Nach der Privatisierung im März 1999 kam es am sogenannten Schloss nur zu unvollständigen Sanierungsmaßnahmen am Dach und an der Fassade, der Gesamtzustand des Gebäudes verschlimmerte sich über die Jahre zusehends. Es gab immer wieder Überlegungen wie diese bedeutende Anlage gerettet werden könnte, aber eine wirkliche Perspektive entwickelte sich nicht.
DER SPIEGEL vom 4. Juni 2012 machte in einem Beitrag mit dem Titel "Kulisse der Geisterschlösser" unter anderem auch auf das traurige Schicksal der Ivenacker Anlage aufmerksam und erregte überregional Reaktionen und Betroffenheit. Seit 2012 hat ein dänischer Investor die Gesamtanlage, abgesehen von dem Marstall, erworben und es besteht die Hoffnung, dass in den nächsten Jahren eine Sanierung und nachhaltige Nutzung des bedeutenden Ensembles erfolgen wird. Zunächst wurde das Herrenhaus bauhistorisch durch den Restaurator Detlef Krohn und den Bauhistoriker Dr. Holger Reimers untersucht.[1] Derzeit wird durch das Architekturbüro Kühn-von Kaehne und Lange ein Gesamtkonzept für die zur Anlage gehörenden Gebäude erarbeitet.
Das sogenannte Schloss Ivenack bildet zusammen mit der Schlosskirche, dem Marstall, dem Teehaus und der Orangerie ein eindrucksvolles barockes Bautenensemble, das durch seine Lage am Ivenacker See mit der Blickbeziehung auf einen barocken Pavillon am gegenüberliegenden Seeufer und eingebettet in einen im Landschaftsstil angelegten Park reizvoll gelegen ist (Abb. 1; 2; 3). Das ehemalige barocke Gutsdorf mit den Gebäuden des Wirtschaftshofes, dem Pfarrhaus, der Schule und den Häusern der Tagelöhner ist als Denkmalbereich geschützt.
Das Dorf Ivenack blickt auf eine lange Geschichte zurück. Hervorgegangen aus einer mittelalterlichen Klosteranlage entstand hier nach der Reformation ein fürstlicher Schlossbau. Dabei wurde, wie jetzt durch die bauhistorischen Untersuchungen nachgewiesen werden konnte, Mauerwerk des ehemaligen Klosterbaus integriert. Von 1593–1600 lebten Herzog Sigismund August und seine Frau Clara Maria von Pommern-Stettin im Schloss, woran ein Sandsteinwappen mit Inschrift an der Fassade erinnert. Im 17. Jahrhundert war Ivenack das Wittumsamt der mecklenburgischen Herzogin Eleonora Maria.
Am 10. April 1709 vollzog sich ein Gütertausch zwischen Herzog Friedrich Wilhelm und Geheimrat Ernst Christoph von Koppelow. Kurz darauf wurde der Renaissancebau des Schlosses umgestaltet. Der Umbau umfasste eine neue Raumdisposition und Fassadengestaltung. Die mittelalterliche Kirche wurde durch den neuen Patronatsherrn baulich stark verändert.
Nach dem Tod von Ernst C. von Koppelow im Jahr 1721 heiratete seine Witwe Juliane von Koppelow 1740 den königlich polnischen und kurfürstlich sächsischen Geheimrat Helmold von Plessen auf Cambs, der 1740 in den Reichsgrafenstand erhoben wurde und Staatsminister und Gesandter beim Dänischen Hof war. Um 1740/43 erfolgte eine Erweiterung des Herrenhauses um die westlich zum See gelegenen Seitenflügel mit Pavillons und die Neuausstattung des Hauptgebäudes im Rokokostil (1743d). Helmold Graf von Plessen ließ auch den Marstall, die Orangerie und das Teehaus erbauen und nahm Umbaumaßnahmen an der Kirche vor. Er verstarb 1761 und vererbte die Ivenacker Güter seinem Neffen Hellmuth Burchard Freiherr von Maltzahn, Sohn des Axel Albrecht von Maltzahn aus dem Hause Kummerow, ab 1765 Graf von Plessen. Unter ihm fanden am Herrenhaus keine größeren Baumaßnahmen statt. Die Kirche wurde abermals 1769 renoviert, der Turm von Norden nach Westen verlagert und die Westfassade barockisiert.
Albrecht Joachim Maltzahn auf Rottmannshagen ließ die westlich gelegenen Pavillons mit den Zwischenbauten des Herrenhauses zu durchgehenden Flügeln umgestalten (1798d–1804) und nahm kleinere Umbauten und Ergänzungen der Ausstattung vor. Unter Adolf Rudolf Carl Felix Freiherr von Maltzahn Graf von Plessen wurden ab 1868d die Fassaden überarbeitet und die Südfassade neu gestaltet sowie einige Neuausstattungen im Inneren vorgenommen. Das Gut blieb 1945 bis zum Einmarsch der Roten Armee in Besitz des Albrecht Adolf Lebrecht Helmuth Freiherr von Maltzahn Graf von Plessen und seiner Frau Magdalena. Das Herrenhaus wurde aber bereits ab 1930 aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr bewohnt.
Die erhaltenen Gebäude des Ensembles um das Herrenhaus sind als Um- oder Neubauten in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden. Das Herrenhaus ist eine zweigeschossige Dreiflügelanlage mit Mansarddach (Abb. 4). Die Fassade wird durch einen Mittelrisalit und vorgezogene Seitenrisalite mit Lünettengiebeln gegliedert, deren Giebel durch Reliefs und Wappen besonders betont werden (Abb. 5; 6; 7). Die typisch barocke Grundrissdisposition zeigt im Erdgeschoss mittig ein Vestibül, von dem rechts und links eine Enfilade abgeht und das rückwärtig in das eindrucksvolle repräsentative Treppenhaus führt (Abb. 8), das nahezu identisch mit dem Treppenhaus im Kummerower Gutshaus ist. Zwischen den Bauherren der beiden Häuser bestanden enge verwandtschaftliche Beziehungen. Der Große Festsaal im zweiten Geschoss hat eine Rokokofassung mit geschnitzten Rahmen und Täfelungen sowie eine Stuckdecke. Die Gobelins sind nicht erhalten geblieben. In fast allen Räumen gibt es Stuckdecken, die in die Zeit um 1709 und um 1743 datieren, im Südflügel befinden sich einige jüngere Deckengestaltungen. Außerdem sind Parkettböden, Paneele und Türen bewahrt worden (Abb. 9).
In Ivenack befand sich ein bedeutendes Gestüt. Die bekanntesten Pferde waren der 1785 gekaufte Beschäler Morwik Ball, der dann Vater des berühmten Ivenacker Zuchthengstes Herodot (1794–1829) wurde. Der wohl um 1730/50 errichtete Marstall hat einen halbkreisförmigen Grundriss mit pavillonartigen Kopfbauten, Mittelrisalit und Mansarddach und eine rückseitig angebaute Reithalle. Es ist abgesehen von dem Marstall der Gutsanlage in Diekhof der einzige erhaltene repräsentative barocke Marstallbau in Mecklenburg-Vorpommern. Ein in der halbrunden Grundrissform vergleichbarer Marstall findet sich auf der Schlossanlage Ludwigsburg in Waabs, Kreis Rendsburg-Eckernförde, der 1742 von dem Baumeister Johann Gottfried Rosenberg für den dänischen Diplomaten Graf Friedrich Ludwig von Ahlefeldt Dehn errichtet wurde. Der Ivenacker Marstall nimmt heute in den beiden Flügeln Wohnungen auf. Der Mittelteil ist noch in einem unsanierten Zustand. Hier sind noch Pferdeboxen erhalten.
Das barocke Gebäude der Orangerie in Ivenack steht direkt an der Dorfstraße am östlichen Rand des Schlossparks (Abb. 10).[2] Diese Stellung als erstes Gebäude im Gartenensemble und in großer räumlicher Entfernung zum Herrenhaus und zum Wirtschaftshof ist typisch für die Entstehungszeit und der Kategorie "Orangerie im eigenen Orangeriequartier" zuzuordnen. Die Orangerie war hier nur ein interner Höhepunkt im Gartenensemble, jedoch nicht Garten beherrschend. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es abgesehen von der Ivenacker Orangerie keine bedeutenden Orangeriebauten der Barockzeit mehr. Die Orangerie in Ivenack ist der wichtigste erhaltene Barockbau dieser Gattung in Mecklenburg-Vorpommern. Ähnliche Bauten standen auf den Gütern in Groß Gievitz und vermutlich Dalwitz und Remplin. Die Architektur der Südseite der Ivenacker Orangerie, die geprägt wird von großen rundbogig abschließenden Fenstern, einer Pilastergliederung und einem mittigen Eingang mit doppelter Pilasterrahmung und einer bekrönenden Schmuckgaube auf dem Mansarddach ist für den Bautyp charakteristisch und zeittypisch. Stilistisch vergleichbar sind Bauten wie die Orangerien der Residenzen in Ansbach und Darmstadt-Bessungen.
Das Teehaus liegt südöstlich vor dem Herrenhaus am Ufer des Ivenacker Sees. Es ist ein eingeschossiger, breit gelagerter Putzbau mit halbrundem Mittelrisalit und Walmdach, das an allen Seiten mit regelmäßigen Fensterachsen versehen ist (Abb. 11). Die ursprünglich höheren Fenster wurden um 1956, als das Gebäude für Wohnzwecke genutzt wurde, verkleinert, ansonsten ist der barocke, flach reliefierte Putz erhalten geblieben. Im Inneren befinden sich im Erdgeschoss und in den gewölbten Kellerräumen zwei Säle auf einem ovalen Grundriss. Es ist das einzige überlieferte barocke Teehaus in Mecklenburg-Vorpommern, die anderen zeitgleichen Beispiele sind kleinere Teepavillons. Stilistisch vergleichbar ist das am Seeufer gelegene Teehaus auf der Gutsanlage in Valdemar Slot auf der Insel Tasinge in Dänemark, das nach einem Entwurf von Georg Dietrich Tschierske um 1754/56 erbaut wurde.
Aufgrund seiner besonderen Geschlossenheit und des hohen Bestandes an barocken Gebäuden stellt der Ort Ivenack ein seltenes und gut erhaltenes Beispiel eines mecklenburgischen Gutsdorfes dar. Das Ensemble um das Herrenhaus ist in seiner räumlichen und gestalterischen Einheit ein herausragendes Denkmal mecklenburg-vorpommerscher Adelsgeschichte und Wohnkultur und aus der Sicht des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege von nationaler Bedeutung.
Beatrix Dräger-Kneißl
Anmerkungen
[1] Detlef Krohn/Holger Reimers, Schloss Ivenack – Restauratorische und bauhistorische Bestandserfassung, erste Phase, 24.06.2013.
[2] Orangerien und historische Glashäuser in Mecklenburg-Vorpommern. – Baukunst und Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern 2. Schwerin 2009.
Denkmal des Monats Juli 2013
Schlossanlage Ivenack im Fokus

Abb. 1: Ivenack, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte, Messtischblatt, Detail, 1880

Abb. 2: Ivenack, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte, Kirche, Marstall und Herrenhaus von Süden, 2013
LAKD M-V/LD, A. Bötefür

Abb. 3: Ivenack, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte, Herrenhaus und Marstall von Südosten, 2012
LAKD M-V/LD, A. Bötefür

Abb. 4: Ivenack, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte, Herrenhaus von Osten, 2013
LAKD M-V/LD, A. Bötefür

Abb. 5: Ivenack, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte, Herrenhaus, Mittelrisalit, Giebel, 2012
LAKD M-V/LD, A. Bötefür

Abb. 6: Ivenack, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte, Herrenhaus, südlicher Seitenrisalit, 2012
LAKD M-V/LD, A. Bötefür

Abb. 7: Ivenack, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte, Herrenhaus, nördlicher Seitenrisalit, 2012
LAKD M-V/LD, A. Bötefür

Abb. 8: Ivenack, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte, Herrenhaus, Treppenhaus, 2013
LAKD M-V/LD, A. Bötefür

Abb. 9: Ivenack, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte, Herrenhaus, Gartensaal, 2013
LAKD M-V/LD, A. Bötefür

Abb. 10: Ivenack, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte, Orangerie, 2008
LAKD M-V/LD, A. Bötefür

Abb. 11: Ivenack, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte, Teehaus, 2011
LAKD M-V/LD, A. Bötefür