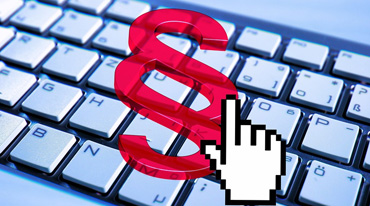Der hölzerne Kirchturm von St. Marien in Neu Boltenhagen - ältester Holzständerturm Deutschlands entdeckt
Denkmal des Monats April 2016


Abb. 1. Neu Boltenhagen, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Kirchturm, Südseite, 2015
Foto: G. Thalmann
Abb. 1. Neu Boltenhagen, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Kirchturm, Südseite, 2015
Foto: G. Thalmann
Landläufig begegnen dem aufmerksamen Beobachter auf Kirchhöfen hölzerne Glockentürme, die nicht nur das Kirchengeläut tragen, sondern auch schon von weitem als Landmarke die Ortsbilder prägen (Abb. 1). Diese Türme stehen meistens im Westen der Kirchen, mitunter vereinzelt auch als "Campanile"" seitlich von ihnen. Bedingt durch ihre vollständig aus Holz bestehende Konstruktion waren sie entgegen ihrer massiv in Stein gemauerten Verwandten in den vergangenen Jahrhunderten – so weisen es oft die in den Pfarrarchiven greifbaren Quellen aus – immer wieder erneuert worden. Dies führte dazu, dass sich die bau- und kunsthistorische Forschung bisher kaum mit ihnen beschäftigte, scheinen doch die recht schmucklos und schlicht wirkenden Holzständerbauten wenig Interessantes zu bieten.
Dies war auch der Grund, weshalb nur ganz vereinzelt in den letzten Jahrzehnten durch Bauforscher wie Konrad Bedal (1977) oder Tilo Schöfbeck (2014) hölzerne Kirch- und Glockentürme auf ihr Gefüge und Alter hin untersucht wurden. Wegen der jedoch vermeintlich seltenen überhaupt noch in Europa erhaltenen mittelalterlichen Bauwerke dieser Gattung schenkte die allgemeine Wissenschaft diesem Forschungszweig keine weitere Beachtung. Dies mag sicher auch daran liegen, dass die schon vielfach erneuerten Verbretterungen der Türme über das wahre Alter der hölzernen Bauten hinwegtäuschen. Darüber hinaus erfolgten die Baudatierungen oft nur über neuzeitliche Inschriften und archivalische Überlieferungen, die zumeist Reparaturen und konstruktive Ertüchtigungen oder auch Turmhelmerneuerungen belegen, ohne die charakteristischen Gefügedetails, Bearbeitungsmerkmale und Abbundzeichen mittelalterlicher Konstruktionen zu berücksichtigen. Somit wurde fast der gesamte Bestand an hölzernen Kirchtürmen bauhistorisch in das 17. und 18. Jahrhundert datiert.
Die aktuell im Rahmen eines Dissertationsprojektes des Verfassers systematisch und flächendeckend durchgeführte Erfassung und Erforschung führte zu erstaunlichen Untersuchungsergebnissen, die zeigen, dass sich durchaus noch ein umfänglicher und großartiger Bestand an weit über 60 hoch- bis spätmittelalterlichen Holzständerbauten, die als Kirch- und Glockentürme fungieren, in unterschiedlichen Bauarten und Gefügedetails über die Jahrhunderte erhalten hat. Separat stehende Holztürme wie auch auf ein massiv gemauertes Untergeschoss gesetzte oder in den Dachraum des Kirchenschiffes integrierte Turmlösungen zeigen dabei die Vielfältigkeit der baulichen Formen. Die Forschungen bezogen sich nicht nur auf noch erhaltene, sondern auch auf bereits verlorene hölzerne Türme, die über historisches Bildmaterial aus Archiven oder bauarchäologische Erkenntnisse nachgewiesen werden konnten. Ein kleiner Teil dieses Bestandes wurde 2015 auf der ANTIKON-Fachwerktagung in Szczecin (Stettin/Polen) vorgestellt.
Als bislang älteste erhaltene Vertreter der mittelalterlichen Holzständerbauten galten die von Tilo Schöfbeck bestimmten Kirch- und Glockentürme von Groß Tessin (ummauert) bei Wismar von 1345 (d) und Altenkirchen auf Rügen von 1360 (d). Weiterhin konnte auch noch in der Rostocker St. Marienkirche im mittleren Turmhelm ein großes Ständergerüst von 1336 (d) identifiziert werden. Noch ältere Beispiele aus der Zeit des hochmittelalterlichen Landesausbaus im 12. und 13. Jahrhunderts waren seit Beginn der Forschungen ganz vereinzelt nur indirekt über dokumentierte Bauspuren (Negativabdrücke oder bescheidene Restgefüge) nachzuweisen.
Die exakte meist sogar jahrgenaue bauhistorische Bestimmung und Einordnung mittelalterlicher Holzbauten hat gerade in den letzten Jahrzehnten durch die Dendrochronologie wesentliche Fortschritte gemacht. Voraussetzung für eine gezielte Erfassung und Datierung sind jedoch immer genaue Kenntnisse der historischen Konstruktionen und ihrer Eigenarten. Wesentliche Gefügemerkmale zeigen sich hier nämlich unverkennbar im mehrfach verriegelten und kreuzverstrebten Ständerbau, der je nach Zeitstellung und Region leicht bis stark geböscht ist. Die Knotenpunkte der aussteifenden Verstrebungen sind dabei immer geblattet und weisen in der Regel die typischen Abbundzeichen mittelalterlicher Holzkonstruktionen auf. In der Regel sind dies einfache additive Zählsysteme, die ebenso in den Dachwerken gleicher Zeitstellung auftreten. Mitunter sind aber auch simple Zeichensysteme als Symbolmarken für die dreidimensionalen Abbünde zu finden.
Der schon in seiner äußeren Form eigentümlich anmutende hölzerne Kirchturm in Neu Boltenhagen (Amt Lubmin) bei Greifswald (Abb. 2) geriet allein durch seinen geböschten Turmschaft in den Fokus dieser Forschungen. Schon bei der ersten Begehung konnte ein mittelalterliches Ständergrundgerüst identifiziert werden, das durch spätere Ein- und Umbauten verändert worden war (Abb. 3). Aus dem hölzernen Turmgefüge in Neu Boltenhagen wurden folgend systematisch im Rahmen von zwei Untersuchungskampagnen insgesamt 17 Holzproben zur Altersbestimmung und Bauphasenermittlung entnommen. Die dendrochronologische Messung und Auswertung erfolgte im Berliner Dendrolabor des DAI durch Karl-Uwe Heußner. Das bereits aufgrund von signifikanten Konstruktionsmerkmalen und Holzspezifika für den Ursprungbau angenommene hohe Alter übertraf dabei alle Erwartungen. Die geschossübergreifenden Hochständer des geböschten acht Ständer umfassenden Grundgerüstes wurden in einer einheitlichen Schlagphase bereits im Winter 1258/59 (d) gefällt. Die bauzeitlich von außen (Abb. 4) und innen aufgeblatteten und damit die ganze Konstruktion über alle Ebenen aussteifenden Kreuzverstrebungen (Abb. 5) stammen den Fälldaten zufolge aus den Jahren 1264-66 (d). Die Blattverbindungen der Knotenpunkte sind dabei als Hakenblätter mit Versatz ausgeführt (Abb. 6 - 7). Der Neu Boltenhagener Kirch- und Glockenturm dürfte – dies zeigen die Trocknungsrisse, die die alten Abbundzeichen (Zimmermannszeichen) durchziehen – dadurch spätestens im Frühjahr/Sommer des Jahres 1267 abgebunden und errichtet worden sein. Mit dieser Datierung ist das Gefüge des Ständerbaus aus Eichenholz fast genau 750 Jahre alt und damit zurzeit mit Abstand der älteste erhaltene hölzerne Kirchturm Deutschlands. Selbst im mitteleuropäischen Raum ließ sich bisher keine ältere vergleichbare Holzturmkonstruktion finden. Eine kleine Sensation!
Erwartungsgemäß erlebte der gesamte Kirchenbau in Neu Boltenhagen (Abb. 8) über die Jahrhunderte mehrere Reparaturen und Ertüchtigungen sowie auch Erneuerungen, was sich in der komplexen Baugeschichte des Gebäudes wiederspiegelt. Zum hölzernen Glockenturm gehörte ursprünglich ein bescheidener Kirchensaal, von dem möglicherweise noch ein Paar Spaltbohlen als Sturz in einer Nische des Nachfolgebaus wiederverwendet wurden. Der im heutigen Kirchenraum stehende spätromanische Taufstein aus Granit (Abb. 9) dürfte ebenso aus diesem ersten sakralen Gebäude stammen. Um 1290, also schon eine Generation nach diesem wahrscheinlich rein aus Holz gefertigten Kirchenbau, entstand der heutige Rechteckchor mit Nordsakristei als massiver gotischer Backsteinbau. Das zweijochige Kirchenschiff folgte vermutlich nach Abbruch des hölzernen Vorgängers in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Der zur ersten Kirche gehörende Glockenturm blieb dabei jedoch bestehen, was u. a. die Bauspuren (Negativabdrücke) an der gemauerten Westwand des Kirchenschiffes gegen die alte Turmkonstruktion belegen (Abb. 10).
Nach mehr als zwei Jahrhunderten, 1490/91 (d), erfolgte im hölzernen Kirchturm von Neu Boltenhagen eine konstruktive Verstärkung durch den Einbau eines aussteifenden Langriegels für die Ständerebene. Gleichzeitig wurde auch der womöglich baufällig gewordene Turmhelm des 13. Jahrhunderts erneuert. Schon 100 Jahre später führte ein unbekanntes Ereignis dazu, dass die Spitze des spätgotischen Turmhelms unter Erhalt des unteren überkragenden Turmkranzes bereits 1596 (d) wieder erneuert werden musste, denn 1592 wird noch im Memorabilien-Buch des Pfarrarchives berichtet, dass sich die Kirche in einem guten Zustand befindet und im Kirchturm drei Glocken hängen. Im Jahre 1605 entstand laut einer Inschrift der kleine Fachwerkvorbau an der Südseite des Chores. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde unter dem Patronat der adligen Familie von Wakenitz der gesamte Kirchenbau 1698 (d) instandgesetzt. Dabei erfolgten auch einige kleinere Holzreparaturen und Auswechslungen. Schon kurze Zeit später, um das Jahr 1728, schien man in Neu Boltenhagen Sorge wegen der Standsicherheit des Glockenturms gehabt zu haben, sodass in das alte Turmgefüge ein zusätzliches tragendes Holzgerüst eingefügt wurde. Das dafür verwendete einheimische Kiefernholz datiert über eine mehrjährige Einschlagphase in die Jahre 1723-1727 (d). Mit dem chronikalisch 1766 überlieferten Einsturz der gewölbten Decken erhielt der Sakralbau nachfolgend hölzerne Tonnengewölbe im Chor und Kirchenschiff, was dendrochronologisch auch bestätigt werden konnte und an dieser Stelle die ältere Baugeschichte abschließen soll.
Neu Boltenhagen – gegründet in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts – findet 1410 erst relativ spät seine erste schriftliche Erwähnung in den Urkunden, kann nun aber wegen seines hölzernen Glockenturmes ein gebautes Zeugnis aus der Frühzeit des Ortes vorweisen und darüber hinaus noch den ältesten zu großen Teilen erhaltenen Holzständerturm Deutschlands und sogar Mitteleuropas.
Gordon Thalmann
Denkmal des Monats April 2016
Der hölzerne Kirchturm von St. Marien in Neu Boltenhagen -
ältester Holzständerturm Deutschlands entdeckt

Abb. 1. Neu Boltenhagen, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Kirchturm, Südseite, 2015.
G. Thalmann

Abb. 2. Neu Boltenhagen, Kirche, Holzständerturm von Nordwesten, 2015.
G. Thalmann

Abb. 3. Neu Boltenhagen, Ständergerüst mit Kreuzverstrebung auf der Nordseite des Kirchturms mit jüngeren Einbauten und Reparaturen.
G. Thalmann

Abb. 4. Neu Boltenhagen, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Kirche, äußere aufgeblattete Kreuzverstrebung Ostseite - Blick von oben.
G. Thalmann

Abb. 5. Neu Boltenhagen, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Kirche, Ständergerüst, Kreuzverstrebung mit Knotenpunkt.
G. Thalmann

Abb. 6. Neu Boltenhagen, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Kirche, bauzeitlicher Knotenpunkt am nordwestlichen Eckständer - Hakenblatt mit Versatz.
G. Thalmann

Abb. 7. Neu Boltenhagen, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Kirche, desolater Fuß- und Knotenpunkt am nordöstlichen Eckständer mit Strebe.
G. Thalmann

Abb. 8. Neu Boltenhagen, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Kirche, Nordseite.
G. Thalmann

Abb. 9. Neu Boltenhagen, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Kirche, Granittaufe.
G. Thalmann

Abb. 10. Neu Boltenhagen, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Negativabdruck an der Kirchenschiffwestwand einer ehemaligen Kreuzverstrebung des Kirchturms.
G. Thalmann