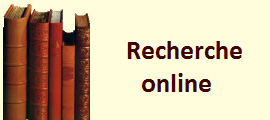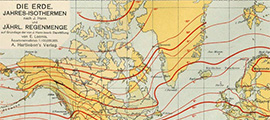Der zerstörte jüdische Friedhof Schwerin im Jahr 1945
Archivalie des Monats Februar 2022


Abb. 1: Der zerstörte jüdische Friedhof in der Schweriner Bornhövedstraße (LHAS, 5.12-7/1, Nr. 9047a)
Abb. 1: Der zerstörte jüdische Friedhof in der Schweriner Bornhövedstraße (LHAS, 5.12-7/1, Nr. 9047a)
Da die meisten Behörden, schon um Platz zu schaffen, früher oder später ihre im Dienstbetrieb nicht mehr benötigten Akten an die zuständigen Archive abgeben, müssen die Archivare sich eigentlich nie Sorgen machen, dass sie keine schriftlichen Quellen zur Geschichte mehr geliefert bekommen. Ganz anders sieht es freilich bei den Bildquellen aus. Hier sind die Archivare sehr auf die Unterstützung historisch interessierter Bürger angewiesen. Ein solcher Glücksfall liegt auch den beiden vorliegenden Fotos zu Grunde. In den 1960er Jahren übergab ein unbekannter Einwohner des Kreises Wismar dem Leiter des dortigen Kreisarchivs, Max Artmeier, zwei Aufnahmen des zerstörten jüdischen Friedhofs Schwerin. Artmeier notierte auf der Rückseite: "Durch SS zerstörter Friedhof der Juden in Schwerin I/M". Da Schwerin nicht zu seinem Zuständigkeitsbereich gehörte, leitete er die beiden Fotos am 26. April 1966 an den Archivar Peter-Joachim Rakow im Staatsarchiv Schwerin weiter, der sie in die Generalakte des Ministeriums für Unterricht und geistliche Angelegenheiten, die Aufsicht über die jüdischen Friedhöfe im Land betreffend, legte. Und in dieser Akte befinden sie sich bis heute.
Tatsächlich wurde der an der Bornhövedstraße gelegene jüdische Friedhof weder während des Novemberpogroms 1938 noch danach von der SS zerstört, sondern bis 1942 ganz regulär für Bestattungen genutzt. Das erwies sich schon deshalb als nötig, weil die Beisetzung von Juden auf dem Friedhof am Obotritenring nach 1933 in der Bevölkerung zu Protesten führte. So beschwerte sich Postdirektor a.D. Georg Reuter im November 1933 darüber, dass der jüdische Unternehmer Georg Hamburger die Grabstelle neben seiner verstorbenen Frau erhalten hatte, "weil es mir schon zuwider ist, daß ein Jude auf einem christlichen Friedhof beerdigt wird". Nachdem im November 1942 die letzten jüdischen Mitglieder der jüdischen Gemeinde Schwerin nach Theresienstadt deportiert worden waren, übertrug die Schweriner Gestapo im Mai 1943 dem Oberfinanzpräsidenten in Kiel die Verwaltung des Grundstücks. Das ungenutzte Areal weckte Begehrlichkeiten. 1950 berichtet der Vorstand der jüdischen Landesgemeinde, was in den letzten Monaten des Krieges hier geschah: "Der Schweriner Friedhof war durch die Schweriner Flak-Truppe völlig zerstört worden. Ohne Notwendigkeit waren Steine zerschlagen worden, jedes Stückchen Land war zerwühlt". Die für Schwerin zuständige Luftabwehrabteilung der Wehrmacht hatte offensichtlich die Grabsteine als Bodenbelag für eine Flakstellung verwandt, Unterstände und Splitterschutzgräben angelegt.


Abb. 2: Zerstörte Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof in Schwerin (LHAS, 5.12-7/1, Nr. 9047a)
Abb. 2: Zerstörte Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof in Schwerin (LHAS, 5.12-7/1, Nr. 9047a)
Als sich 1946 eine kleine Gruppe von Juden, die den Krieg überlebt hatten, in Schwerin zusammenfand und die Neugründung einer jüdischen Gemeinde ins Auge fasste, bot der Friedhof einen erschütternden Anblick. Das Foto zeigt den Blick nach Norden über die zerschlagenen Grabsteine hinweg bis zur ebenfalls teilweise zerstörten Friedhofmauer und weiter über den Heidensee die am Eichen- und Buchenweg stehenden Häusern auf dem Schelfwerder. In der Folgezeit entstand zwischen 1947 und 1952 auf einem Teil der alten Friedhofsfläche eine Gedenkstätte, auf der auch 58 unbeschädigte alte Grabsteine wieder aufgestellt wurden. Die DDR-Regierung maß dieser Aktion große außenpolitische Bedeutung bei. 1951 erklärte der Gemeindevorsitzende Dr. Franz Unikower dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Otto Nuschke: "Es ist propagandistisch überaus wichtig, daß wir nach außen zeigen, wie unsere Toten geehrt werden, d.h. daß Gräber angelegt und gepflegt werden. […] Wir können es uns nicht leisten, einem Witwer nach New York zu schreiben, daß mangels Geld wir das Grab seiner Frau nicht herstellen und pflegen können". Bis 1981 fanden insgesamt noch sechs Beerdigungen auf dem jüdischen Friedhof statt. Seitdem hat es hier keine Veränderungen mehr gegeben.
Dr. Bernd Kasten
2025
- Juli: Warum das alte lauenburgische Amt Neuhaus 1945 für 47 Jahre zu Mecklenburg kam
- Juni: Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg fährt 1902 in den Schacht der Kohlenzeche „Constantin IV“ ein
- Mai: Als der 1. Mai in Mecklenburg-Schwerin Feiertag war
- April: Warum Flüchtlinge und Vertriebene in Mecklenburg-Vorpommern 1946 Umsiedler wurden
- März: Die zweite Hauptlandesteilung von 1621
- Februar: Die Fahrenholzer Ämterteilung von 1611
- Januar: In kürzester Frist. Die Vereinigung zwischen Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz zum 1. Januar 1934
2024
- Dezember: Wette mit Folgen - Ein Mann in Frauenkleidern in der Kirche von Kalkhorst
- November: Als Mecklenburg seinen Stiefel verlor. 1950 wurde der Fürstenberger Zipfel brandenburgisch
- Oktober: Mit bestem Dank zum Tag der Deutschen Einheit. Ein Geschenk des Mecklenburger Münzkontors
- September: Ein neuerlicher Traum von Carl Gantzel oder wie ein Malermeister aus Lübz 1912 beinahe ein Aeroplan erfand
- August: Ein Hauch von Exotik. König Chulalongkorn von Siam besucht Herzogregent Johann Albrecht 1897 in Schwerin und 1907 in Braunschweig
- Juli: Achter mit Steuermann. Ruderregatten auf dem Medeweger See bei Schwerin
- Juni: Auf dem Weg zur Reuterstadt. Kreistag Malchin beantragt am 3. Juni 1949 Namenszusatz für Stavenhagen
- Mai: Als der 1. Mai in Mecklenburg-Strelitz Feiertag werden sollte
- April: Warum die Äbtissin von Ribnitz 1499 das Kloster wechseln wollte. Eine Urkunde Papst Alexanders VI. (1492-1503) wirft Fragen auf
- März: Als Mecklenburg-Vorpommern Geschichte ward oder: Wie Vorpommern 1947 von der politischen Landkarte verschwand
- Februar: „Pommern“ und Karenz. Was 1909 einen Ballon aus Greifswald mit einer mecklenburgischen Häuslerei verband
- Januar: Der Geist der Bücher und der Menschen ist unantastbar. Dritte Rede von Adolf Glaßbrenner, gehalten am 11. Dezember 1847 im Gewerbeverein Neustrelitz
2023
- Dezember: Umgehende Drahtantwort. Wie Hans Wendt 1918 die Neustrelitzer Regierung unter Druck setzte
- November: Das letzte Lebensjahr des letzten regierenden Großherzogs von Mecklenburg
- Oktober: Grundrechte für das mecklenburgische Volk. Das Staatsgrundgesetz für Mecklenburg-Schwerin vom 10. Oktober 1849
- September: Eine Luftaufnahme aus dem Jahre 1903? Die Warnemünder Hafeneinfahrt aus der Vogelperspektive
- August: Der Reuterstein in Findenwirunshier
- Juli: Zur Buße eheliche Enthaltsamkeit: Johann IV., Herzog von Mecklenburg (1384-1422), und Katharina von Sachsen-Lauenburg (†1450) hatten unerlaubt geheiratet
- Juni: Der Traum von Carl Gantzel oder wie ein Malermeister aus Lübz 1899 beinahe das Luftschiff erfand
- Mai: Die Entführung eines Königs
- April: Durch Feindeinwirkung zerstört. Der Flugzeugabsturz in Roggow am 11. April 1944
- März: Amouren des Herzogs Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin: Friederike Saal und ihre Töchter
- Februar: Ein Todesfall und zwei Heiraten - Herzog Magnus II. von Mecklenburg (1441–1503) und Herzogin Sophie von Pommern (†1504) gingen lieber auf Nummer sicher
- Januar: "Empörende Entwürdigung des Hauses". Rauchende Militärs, ausschweifende Flüchtlinge und sowjetische Besatzer im Geheimen und Hauptarchiv Schwerin
2022
- Dezember: Großherzog Friedrich Franz IV. von Mecklenburg-Schwerin beim Eishockey
- November: Die Inszenierung des Fotografen. Eggert Hansen und das Fährschiff „Friedrich Franz IV.“
- Oktober: Hinter den Kulissen: Archivarische Magazinarbeit im Wandel der Zeit
- September: 2.000 Mark für einen Fürsten - Anastasia von Mecklenburg versucht 1287, ihren Gemahl aus mamlukischer Gefangenschaft freizukaufen
- August: Der wesentliche Grundstock der ehemaligen Landesbibliothek Neustrelitz: Urkunden zur Schulenburgschen Büchersammlung
- Juli: Die Alterspräsidentin eröffnet den Landtag. Die DNVP-Politikerin Klara Schleker
- Juni: In Teterow am Tag nach Mai? Die Landung des Zeppelins "Hansa" am 21. Juni 1914
- Mai: Die Hebung des Segelschulschiffs "Gorch Fock" vor Stralsund 1947
- April: Von ‘ner Dicke sondergleichen … Ein Laiengedicht über die Ivenacker Eichen aus dem Jahr 1899
- März: Mehr als Worte: Der mecklenburgische NS-Staatsminister Friedrich Scharf in der bildlichen Überlieferung
- Februar: Der zerstörte jüdische Friedhof Schwerin im Jahr 1945
- Januar: Die Erbverzichtserklärung der britischen Königin Sophie Charlotte
2021
- Dezember: Sommer und Winter. Zwei Fotografien des Gutshauses Niekrenz aus dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
- November: Bildbriefköpfe der Großherzogin Alexandrine von Mecklenburg-Schwerin
- Oktober: Als Landtag im Theater war. Der Plan des Lehrers Willi Ruhe für die mecklenburg-schwerinschen Landtage 1919-1933
- September 2021: Domweihe in "wüster Einöde"
- August: Der Bevollmächtigte des Präsidenten des Landes Mecklenburg-Vorpommern für Vorpommern
- Juli: Als die Recknitz-Brücke zum Bindestrich wurde. Die unfreiwillige Fusion zwischen dem mecklenburgischen Ribnitz und dem pommerschen Damgarten
- Juni: Der Erbprinz steigt auf den Thron. 1785 folgt Friedrich Franz I. in Mecklenburg-Schwerin auf Herzog Friedrich den Frommen
- Mai: 300 Jahre Tiergarten Neustrelitz: Vom herzoglichen Jagdrevier zur öffentlichen Erholungslandschaft
- April: "Auf einem Schild mittlerer Größe gemahlt". Das Hoheitszeichen des großherzoglich mecklenburg-schwerinschen Konsulates in Bremen
- März: Die älteste Karte der Stadt Schwerin aus dem Jahr 1740
- Februar: Der grobe Gottlieb zu Dannenwalde. Was einen flüchtigen Strafgefangenen mit einer toten Preußenkönigin und sowjetischen Raketen verbindet
- Januar: Wiederentdeckung einer alten Innovation: Das Flettner-Rotorschiff in Mecklenburgs Vergangenheit und Gegenwart
2020
- Dezember: Macht die Betriebe winterfest! DDR-Gewerkschaft plakatiert 1963 die Unbilden des Winters
- November: Das Photographische Album aus Mecklenburg von A. Mencke & Co. Wandsbek
- Oktober: "Geburtsurkunde" des Landes Mecklenburg-Vorpommern? Wilhelm Höckers Protokollnotiz zum 8. Juli 1945
- September: 800 Jahre Kloster Dobbertin. Die erste evangelische Klosterordnung stammt von 1572
- August: Einer der schönsten Prospecte. Der Rostocker Hafen vom Ballastplatz aus, gezeichnet um 1847
- Juli: Der Große Stadtbrand 1842. Hamburgs Dank für Mecklenburgs Hilfe
- Juni: Theodor Ackermanns mecklenburgischer Cholera-Atlas von 1859: Das Beispiel Dargun
- Mai: Kriegsende 1945: Massensuizid in Stavenhagen
- April: Register des Grauens. Das Sterbezweitbuch des Standesamtes Ivenack 1945
- März: In 120 Jahren: Vom Hirschgarten am Forstgehöft zum europäischen Spitzenzoo in Rostock
- Februar: Unter Kreuzband. Kommunikation des großherzoglichen Konsulates Riga
- Januar: "das wirksamste Mittel": Juden als Lotterieeinnehmer in Mecklenburg-Schwerin
2019
- Dezember: Als die Kirche Recht sprach - Die Stiftung des herzoglichen Konsistoriums in Rostock am 8. Februar 1571
- November: 1419: Papst Martin V. erlaubt die Stiftung einer Universität in Rostock und stattet sie mit Privilegien aus
- Oktober: "Wichtig für die Identität des Landes". Die Verfassung Mecklenburg-Vorpommerns
- September: Seltenes Bilddokument einer mecklenburgischen NS-Formation
- August: "Papa Frahm": Die mecklenburgischen Wurzeln eines deutschen Bundeskanzlers
- Juli: Liste der Schande? „Franzosenkinder“ in Mecklenburg-Vorpommern
2015
2014
2013
2012
- November: Maßnahmen zur Abwehr der Cholera
- September: Es bimmelt! - Ein Hilferuf an die Bevölkerung, bei der Bergung der Kartoffelernte zu helfen
- Juli: Die Bombardierung Ratzeburgs 1693
- Juni: "Ein güste Kindelbier" – Wenn Laien Taufe spielen
- Mai: Aus dem Tagebuch einer Hebamme
- April: Sportplätze für den Frieden – Wie der Fußball auf die Güter Mecklenburgs kam
- März: Wertvolles Salz
- Februar: Feuer, Wasser, Krieg und andere Katastrophen
- Januar: Spionageabwehr in der mecklenburgischen Provinz
2011
- Dezember: Tilgung des Wolfes
- November: Von Blutsaugern und Geisterbeschwörern
- Oktober: Das Gebäude des Landeshauptarchivs in Schwerin wird 100 Jahre alt
- September: Königliche Hochzeit in Mecklenburg-Strelitz vor 170 Jahren
- August: Blitzeinschlag in der Schweriner Schelfkirche anno 1717
- Juli: Das Landeshauptarchiv in Schwerin - 100 Jahre in Bildern
- Juni: Tanzen verboten - Das ausschweifende Leben des Schulzen Godejohann
- Mai: Ehm Welk und der beschwerliche Aufbau der Volkshochschule Schwerin vor 65 Jahren
- April: Abschied vom Amt
- März: Teterow - eine Ansicht aus dem Jahr 1845
- Februar: Du bist, wo du in der Kirche sitzt
- Januar: Hieroglyphen im Landeshauptarchiv Schwerin. Historische Sensation oder originelle Momentaufnahme?
2010
- Dezember: Über Stock und über Stein … Guthendorfer Vieh im Brünkendorfer Roggen
- November: Eine Prachtausgabe für den Oberst Baron Gerhard von Langermann
- Oktober: Restaurierung eines Transparentobjekts aus den Schlossmappen des Landeshauptarchivs Schwerin
- September: Farbige Zeichnungen dänischer Militäruniformen im Nachlass eines Mecklenburgers
- August: Austernzucht in der Ostsee
- Juli: Bunt und kreativ versus Staub und Aktenmief - Das Beerdigungsbuch von Klütz
- Juni: Der Feldzug gegen Mirow
- Mai: Der älteste Stadtplan der Schweriner Vorstadt von 1804
- April: Von Protektoren, hohen Beförderern und ordentlichen Mitgliedern - Matrikelbücher des Vereins für mecklenburgische Geschichte
- März: Die Schweriner Stadtsiegel
- Februar: Verordnung gegen Holzdiebereien in den Königlich Schwedischen Waldungen des Amtes Neukloster
- Januar: Schmuggel an Pommerns Küste - Die Beschlagnahmung der Schiffe "Orion" und "Goede Hoop" im Mai 1808 in Kolberg
2009
- Dezember: Friedrich Wilhelm Buttel - Ein Zeitgefährte von Adolph Demmler
- November: Der Heilige Antonius von Sülten
- Oktober: Neue Plätze für die Toten – Grabkultur in Picher im 18. Jahrhundert
- September: Vineta, die versunkene Metropole des Nordens auf einer Karte schwedischer Landmesser
- August: Der Bau einer "Klein-Kinder-Schule" – Ein Projekt von Hermann Willebrand
- Juli: Die Ostsee muss ein Meer des Friedens sein – die Ostseewochen im Bezirk Rostock
- Juni: Großherzog Friedrich Franz IV. in seinem ersten Automobil im Jahr 1901
- Mai: Zuflucht im Pfarrhaus
- April: Patent gegen die Prozesssucht – Herzog Friedrich wehrt sich 1776 gegen zudringliche Untertanen
- März: TERRA- Schlepper, das Pferd der Zukunft
- Februar: Die Macht der Bilder. Der 30000. Heimkehrer aus sowjetische Kriegsgefangenschaft
- Januar: Schwerin wird verkauft
2008
- Dezember: Elektronische Akten im Archiv der Zukunft
- November: Der lange Weg zum Wiederaufbau von St. Marien in Neubrandenburg
- Oktober: Mecklenburg und die deutschen Währungsreformen im 20. Jahrhundert
- September: Schicksalsjahr 1866 – Das Ende der mecklenburgischen Selbständigkeit
- August: 2.23-4 Kriminalkollegium Bützow (1812-1879) Nr. 647
- Juli: Der Landesgrundgesetzliche Erbvergleich von 1755
- Juni: Der "Löwe aus Mitternacht" streckt seine Pranke nach Mecklenburg aus
- Mai: Mecklenburg im 16. Jahrhundert
- April: Sternberg 1492 und die Folgen
- März: Ein Schatz im Landesarchiv Schwerin
- Februar: Ossenköpp – zur Geschichte der mecklenburgischen Wappenfigur
- Januar: 1158: Papst Hadrian IV. bestätigt das Bistum Ratzeburg
2007
- Dezember: Kuriose Postkarten
- November: 1812 – November: Anweisung der Militärverpflegungsdirektion Rostock
- Oktober: Zeitkritische Dichtung oder "Spottlied über die heutige demokratische Bewegung"?
- September: Die letzte Fürstenhochzeit im regierenden Haus Mecklenburg
- August: Der Ernstfall war vorbereitet - Ein Dokument zum 13. August 1961
- Juli: Unter dem Dach des Landeshauptarchivs
- Juni: Tagebuch einer Reise nach Brasilien im Jahre 1824
- Mai: Stiftung eines Ordens für die Konventualinnen der Landesklöster Dobbertin, Malchow und Ribnitz