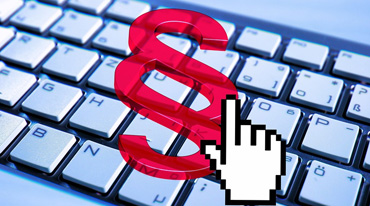Der Kulturpark in Neubrandenburg - Zeugnis der Nachkriegsmoderne und heutiger Freizeitort
Denkmal des Monats April 2020


Abb. 1. Neubrandenburg, Kulturpark, Bänke und Wasserspiele im Eingangsbereich
(Foto: H. Krebber, um 1980).
Abb. 1. Neubrandenburg, Kulturpark, Bänke und Wasserspiele im Eingangsbereich
(Foto: H. Krebber, um 1980).
Der Kulturpark in Neubrandenburg, welcher ab ca. 1970 mit Hilfe der Bevölkerung im Rahmen des Nationalen Aufbauwerks der DDR angelegt wurde, befindet sich südlich der Altstadt, am nördlichen Ufer des Tollensesees. An gleicher Stelle gab es zuvor schon einen Stadtpark, der durch den Verschönerungsverein der Stadt ab ca. 1850 initiiert worden ist.
Der heute ca. 36 ha große Kulturpark ist im Stil eines sozialistischen Volksparks mit repräsentativen Stauden und Blumenpflanzungen, Springbrunnen, einer großzügigen und vielfältig nutzbaren Parkwiese sowie bildkünstlerischen Werken angelegt worden (Abb. 1).
Es gibt Anlagen für Spiel und Bewegung, kleinere Räume mit individuellen Rückzugsmöglichkeiten und Orte für zwanglose Treffen, Vergnügen und Unterhaltung im Park. Außerdem ist er mit Plastiken aktueller Kunst ausgestattet – für Jedermann unentgeltlich und frei zugänglich.
Aus gartenkunsthistorischer Sicht ist zu bemerken, dass für den Kulturpark in Neubrandenburg keine herausragenden neuen Gestaltungsansätze gefunden wurden. Im Gegenteil, man fügte Wege und Bauten in den historischen Bestand ein, der als Kulisse für die Neugestaltung diente. So baut der Kulturpark in Neubrandenburg auf den grundlegenden Gestaltungsprinzipien des früheren Landschaftsgartens im englischen Stil auf, ist aber gleichzeitig durch typische Ausstattungselemente der Nachkriegsmoderne geprägt, wie die nachfolgende Einordnung der einzelnen landschaftsarchitektonischen Entwurfskomponenten zeigt.
Raumbildung:
Bild 1: Tobeplatz, Quelle: Krebber, 1975, S. 103
Der Kulturpark in Neubrandenburg bietet durch separate, unterschiedlich gestaltete Parkbereiche vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, die jeweils auf spezielle Nutzergruppen zugeschnitten sind. Spielplätze für Kinder aller Altersstufen, ruhige Plätze für ältere Menschen, darüber hinaus Sonderbereiche wie der Verkehrsübungsplatz oder das Tiergehege ermöglichen eine Fülle an Aktivitäten in den Grünanlagen (Abb. 2-3).
Die vorhandene Topographie des Geländes wird gestalterisch in seiner Raumqualität ausgenutzt; so vermittelt z.B. die natürliche Weitläufigkeit des Geländes ein Gefühl des Ineinanderfließens der Parkräume. Weite Rasenflächen mit wenigen markanten Bäumen erhalten durch dichte Gehölzpflanzungen in den Randbereichen ihre räumliche Wirkung (Abb. 4).
Besonders markant sind die Sondergärten, die sich mit ihren themenbezogenen Strukturen von den übrigen Parkflächen absetzen. So sollten z.B. in der ursprünglichen Planung des Moorbeetgartens neben Moorbeetpflanzen auch besondere botanische Höhepunkte, wie der Amberbaum (Liquidambar styraciflua) aus Nordamerika oder die japanische Zaubernuß (Hamamelis), gezeigt werden. Diese Pflanzenauswahl ist heute leider nur noch teilweise erhalten.
Materialien der Bodenbeläge:
Bei der Auswahl der Bodenbeläge steht neben Funktionalität und Sicherheit vor allem die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Die Materialknappheit der Zeit forderte Sparsamkeit und einfache Bauweisen. Auf Wegen und Plätzen findet sich zum Beispiel Asphalt als kostengünstige Lösung. Heinrich Krebber, der damals leitende Landschaftsarchitekt, schreibt in seinem Artikel aus dem Jahr 1975 von 660m Bitumendecke.
Außerdem kommen im Kulturpark Waschbetonplatten, 30 x 30 cm, zum Einsatz, wobei bei diesen rechteckigen Formaten der gewollte Effekt von Asymmetrie durch Verlegemuster mit verspringenden Außenkanten erreicht wird. Zusätzlich wird die Eingangssituation gestalterisch durch die Verwendung von verschiedenfarbigen Betonplatten (Grau, Gelb, Rot) aufgewertet.
Gehölze:
Im Kulturpark Neubrandenburg werden vorhandene Gehölzbestände aus Eschen, Birken und Eichen wertgeschätzt und integriert: "Wichtigstes Gestaltungselement eines Kulturparks ist und bleibt jedoch der Baumbestand. Der vordere Parkbereich zwischen Lessingstraße und Kulturparkeingang erhielt durch Neupflanzungen eine völlig andere Gehölzstruktur, während der Bereich in Seenähe vorwiegend von alten Beständen geprägt wird. Die Bäume benötigen wenigstens 20 Jahre, um als Gestaltungselement im Kulturpark voll wirksam zu werden. Deshalb wird unsere Parkanlage erst dann völlig gestaltet sein, wenn der neu angepflanzte Baumbestand das entsprechende Alter erreicht haben wird. So vervollkommnet sich die in den vergangenen sieben Jahren vorgezeichnete Parkstruktur zur Freude, Erholung und Entspannung aller Besucher immer mehr." (Krebber, 1975, S. 17)
Zusätzlich werden einzelne Bereiche durch gezielt gesetzte Ziergehölze gestalterisch auch noch einmal betont. Blütengehölze, wie ein Lorbeerblättriger Schneeball (Viburnum tinus) bieten optische Glanzpunkte. Forsythien, Magnolien und andere frühblühende Arten und Sorten sorgen bereits im Frühling für Farbe; oder bunt-laubige Gehölze für eine intensive Herbstfärbung. Sehr beliebt ist Rhododendron, denn seine Blüte im Mai und Juni ist ein besonderer Höhepunkt. Sommerliche Glanzpunkte setzen auch die Rosenbeete.
In der übrigen Zeit bilden immergrüne Sträucher, zusammen mit Nadelgehölzen wie Wacholder, Eibe oder Zwergkiefer ein dichtes, über das ganze Jahr hinweg in Farbe und Textur gleichbleibend stabiles Grünelement.
Allerdings spielt der Aspekt der wirtschaftlichen Pflege und Pflanzenverwendung auch eine große Rolle, was nicht immer fachgerecht durchgeführt werden konnte, wie dieses Zitat aus dem Jahr 1975 zeigt: "Da die manuelle Pflege der Anlagen hauptsächlich durch Bevölkerungseinsätze durchgeführt wird, müssen z.B. auch Staudenpflanzungen eine einfache, für Laien erfassbare Zusammensetzung haben. Das setzt den Gestaltungsmöglichkeiten gewisse Grenzen." (Krebber,1975, S. 104)
Formsteinmauern:
Ortbetonformstein-Mauern sind leichte, transparente Wandkonstruktionen, die als gestalterisches Mittel eingesetzt werden, um unterschiedliche Parkbereiche räumlich voneinander zu trennen. Im Neubrandenburger Kulturpark trennt eine solche Mauer den Haupteingangsbereich von den halbprivaten Räumen des ehemaligen Hauses der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische-Freundschaft, welches sich heute in privater Hand befindet.
Durch die Perfektionierung der Ortbetonherstellung konnten Sichtbetonmauern zu künstlerischen Gestaltungselementen werden. Vor allem stark strukturierte Oberflächen, die durch unterschiedliche Schalungsmaterialien und -einlagen entstehen, sind ein typisches Merkmal der Zeit.
Kleinarchitekturen:
Kleine Architekturen wie das Ponyhaus sind typische Gestaltungselemente der Grünanlagen dieser Zeit.
Das Erscheinungsbild dieser Kleinarchitekturen ist durchaus vielfältig, je nachdem, ob sich die Planer*innen traditionellen oder modernen Gestaltungsmustern verpflichtet sahen. Dem entsprechend zeigen sich auch die verwendeten Materialien und die Kombinationen untereinander. Bei dem Ponyhaus setzte man auf die traditionelle Bauweise eines reetgedeckten Strandhauses (Abb. 5).
Spielplätze:
Die im Kulturpark angelegten Spielplätze boten den Kindern mit fortschreitendem Wiederaufbau Orte, an denen sie sich abseits vom Verkehr sicher aufhalten konnten. Das Angebot reichte vom einfachen Sandkasten bis hin zu Nutzungsangeboten für höhere Altersstufen. Neben klassischen Spielgeräten wie Wippen, Rutschen und Klettergerüsten – typisch aus buntem Metallrohr - gibt es auch skulpturale Elemente wie der aus Beton gefertigte Stier, der nach dem Vorbild der Bildhauer Vinzenz Wanitschke, Johannes Peschel und Egmar Ponndorf von der Dresdner Produktionsgenossenschaft ‚Kunst am Bau‘ (1962) entworfen wurde (Abb. 6-8).
Sitzmöglichkeiten:
Ein vielfältiges Angebot von bequemen Sitzmöglichkeiten und Bänken lädt im Neubrandenburger Kulturpark zum längerem Verweilen und Ausruhen ein. (vgl. Krebber, 1977, S. 17) Die am Wasserspielplatz fest installierten Sitzgelegenheiten sind zudem so angeordnet, dass der Besucher in den offenen Raum, auf den Brunnen blickt. Rückwärtig ist er durch eine Hecke geschützt, wodurch ein Gefühl von Intimität und Geborgenheit hervorgerufen wird.
Wasseranlagen:
Die jahrhundertealte Tradition, Grünanlagen durch Wasseranlagen zu schmücken und aufzuwerten, lebt auch im Neubrandenburger Kulturpark fort. So zeigt eine historische Fotografie im Eingangsbereich ein quadratisches Becken, durch welches bewusst Künstlichkeit, durch klar erkennbare Randkonturen, demonstriert wird. Die Fontäne setzt dabei zusätzlich lebendige Akzente (Abb. 9).
Kunstobjekte:
Im Aufbau der sozialistischen Gesellschaft in der DDR setzte sich die Prämisse durch, dass Kunst für jedermann zugänglich sein muss. Deshalb wurden vielerorts Skulpturen im öffentlichen Bereich aufgestellt.
Im Kulturpark in Neubrandenburg sind es zumeist realistische Darstellungen, die sich am klassischen Ideal des Menschen orientieren, indem sie sich u.a. sehr detailreich zeigen. Sie folgen somit dem Vorbild des sozialistischen Realismus. Die figürlichen Darstellungen repräsentieren in ihrer Haltung, durch teilweise pathetische Gesten, durch ihre Tätigkeit und Kleidung die Ziele und Errungenschaften des Sozialismus. Für Neubrandenburg sind dies, als Stadt des Sports, Sportdarstellungen, die den Park besonders prägen.
Ausblick
Die Erhaltung des Neubrandenburger Kulturparks ist nicht nur aus denkmalpflegerischer Sicht notwendig, sondern auch, weil zu erwarten ist, dass die Anlage wertvolle Anregungen für die Zukunft der Stadt liefern kann:
- Aufgrund des demographischen Wandels ist die alternde, weniger mobile Stadtbevölkerung auf quartiersnahe Freiflächen wie den Kulturpark angewiesen.
- Sportbegeisterte und Gesundheitsbewusste wissen diese Grünverbindungen zu schätzen.
- Artenreich gestalteten Staudenpflanzungen können eine flexible Antwort auf ökologische Fragestellungen (u.a. als Bienenweide) geben.
- Die vorhandenen Freiflächen sind sowohl Versickerungs- als auch Verdunstungsflächen innerhalb eines stark versiegelten urbanen Gebietes.
Der Kulturpark in Neubrandenburg ist ein bedeutendes Zeugnis des gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aufbruchs der DDR, vorgeführt mit den stilistischen Mitteln der Nachkriegsmoderne. Er spiegelt in seiner Formensprache und Materialverwendung die Rahmenbedingungen seiner Entstehung wieder und hat daher nicht nur eine lokale und regionale Bedeutung für Neubrandenburg, sondern ist in seiner Gesamtheit als wichtiges Kultur- und Naturerbe des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern einzustufen.
Es sollte ein Anliegen sein, ihn nicht aus falsch verstandenen Sanierungsansätzen heraus oder nicht fachgerechter Pflege so zu verändern, dass seine Grundidee verloren geht.
Prof. Dr. Caroline Rolka
Literatur:
Karn, Susanne (1998): der Kulturpark – ein sozialistischer Park oder eine Sonderform des Volksparks? Zur Planung Walter Funckes auf dem Gelände des Parks in Babelsberg, In: Barth, Holger (Hrsg.), Projekt sozialistische Stadt, Beiträge zur Bau- und Planungsgeschichte der DDR, Dietrich Reimer Verlag Berlin.
Krebber, Heinrich (1975): Der Neubrandenburger Kulturpark – ein ungewöhnliches Initiativobjekt, In: Landschaftsarchitektur, Bund der Architekten der Deutschen Demokratischen Republik, Heft 4.
Krebber; Heinrich (1977): Sieben Jahre Neubrandenburger Kulturpark, In: Neubrandenburger Mosaik, Schriftenreihe des kulturhistorischen Museums Neubrandenburg.
Denkmal des Monats April 2020
Der Kulturpark in Neubrandenburg - Zeugnis der Nachkriegsmoderne und heutiger Freizeitort

Abb. 1. Neubrandenburg, Kulturpark, Bänke und Wasserspiele im Eingangsbereich
(Foto: H. Krebber, um 1980).

Abb. 2. Neubrandenburg, Kulturpark, Tobeplatz für Kinder
(aus Neubrandenburger Mosaik, um 1980).

Abb. 3. Neubrandenburg, Kulturpark, Spielhütten an der Messehalle
(Foto: H. Krebber, um 1980).

Abb. 4. Neubrandenburg, Kulturpark, Blick zur Gaststätte "Karelien"
(Foto: H. Krebber, um 1980).

Abb. 5. Neubrandenburg, Kulturpark, Pony-Haus
(Foto: H. Krebber, um 1980).

Abb. 6. Neubrandenburg, Kulturpark, Klettergerüst "Dromedar", 2019
(Foto: LAKD M-V/LD, C. Rolka).

Abb. 7. Neubrandenburg, Kulturpark, Kletterskulptur "Stier"
(Foto: H. Krebber,1977).

Abb. 8. Neubrandenburg, Kulturpark, Kletterskulptur "Stier", 2019
(Foto: LAKD M-V/LD, C. Rolka).

Abb. 9. Neubrandenburg, Kulturpark, Wasserspiel im Eingangsbereich,
(Foto: H. Krebber, um 1980).
2025 - Denkmale des Monats
- Juni: Griechische Mythologie am Alten Garten in Schwerin - Der Portikusgiebel des Galeriegebäudes
- Mai: Der Senkgarten in Ziethen
- April: Die Werke des Herrn H. - Dem Architekten Heinrich Handorf zum 100. Geburtstag
- März: Ein Ungeheuer mitten in Rostock
- Februar: Die „Blaue Scheune“ in Vitte – ein Künstlerhaus auf der Insel Hiddensee
- Januar: Die Hufschmiede in Altenhagen im Landkreis Rostock
2024 - Denkmale des Monats
- Dezember: Vom Denkmalwert der ländlichen Kirchhöfe und die Kirchhofsmauer in Trent auf Rügen
- November: Ad fontes – Der Glashäger Quellentempel bei Bad Doberan und seine Einbindung in die Kulturlandschaft des Hofgutes Glashagen
- Oktober: Das Giebelbild „Florale Formen“ in Rostock-Schmarl: Inge Jastram im Spiegel ihrer architekturbezogenen Kunst
- September: Das Residenzensemble Schwerin – seit dem 27. Juli 2024 UNESCO-Welterbe
- August: Das Epitaph der Sabine Hedwig von Putbus in der Maria-Magdalena Kirche Vilmnitz – Neue Wege zur Korrosionshemmung für eiserne Haltekonstruktionen
- Juli: Weiterbauen am Denkmal – Umbau, Sanierung und Restaurierung des Gutshauses in Broock
- Juni: Das „Haus der Erholung“ in Ahlbeck – Ein etwas anderes Kulturhaus
- Mai: Letzte Grüße in Mukran. Sowjetische Soldaten und ihr Abzug aus Deutschland
- April: Der Aussichtsturm auf Behm’s Höhe und der Luftkurort „Augustabad bei Neubrandenburg“ – Von der Wiederentdeckung eines kulturlandschaftlichen Zusammenhangs
- März: Großbürgerliches Wohnen im Zeitalter des Historismus – ein Stralsunder Traufenhaus mit langer Geschichte
- Februar: Das Haus eines ehemaligen Assessors des schwedischen Tribunals in Wismar, Beguinenstr. 2
- Januar: Wechselwirkungen zwischen Landschaftsraum und Architektur: Das Herrenhaus und der Park Burg Schlitz in der Mecklenburgischen Schweiz
2023 - Denkmale des Monats
- Dezember: „Masel tov“ dem neuen Eigentümer der ehemaligen Synagoge in Bützow
- November: Arboretum oder kein Arboretum – Der Blücherhof bei Klocksin
- Oktober: Schiffskehlen und Wellen aus Backstein am Gutshaus Groß Salitz
- September: Juno und Ceres, zwei Antikenkopien, vervollständigen das Schweriner Schloss
- August: Das Rathaus der Stadt Marlow
- Juli: Das Buswartehäuschen in Buschvitz – ein Kleinod im Werk von Ulrich Müther
- Juni: Das Bankgebäude Tribseer Straße 1 in Stralsund – Ein „Meisterstück Stralsunder Gewerbefleißes und handwerklicher Qualitätsarbeit“
- Mai: „Im tannenumrauschten Gelbensande [...]“ - Das großherzogliche Jagdhaus und sein Wirkungsraum
- April: Ein hoffnungsloser Fall? Die Sanierungsgeschichte des Wasserschlosses von Quilow.
- März: Paul Korff und sein Einfluss auf die Gestaltung der Außenbereiche um die von ihm gestalteten Gutsanlagen in Mecklenburg
- Februar: Die städtebauliche Gestalt der Gutsanlage in Bristow und ein originelles Geflügelhaus
- Januar: Die Stadthalle in Neubrandenburg
2022 - Denkmale des Monats
- Dezember: Die Märchensäule in Neubrandenburg - ein beliebtes Kunstwerk ist zurück
- November: Die Wandmalereien in der Dorfkirche Lohmen
- Oktober: Architektur zwischen Tradition und Moderne - das Landeskinderheim in Güstrow
- September: Das immaterielle Denkmal - Die Burg in Warin
- August: Die gärtnerisch gestalteten Freiflächen des Erich-Steinfurth-Kindererholungsheims in Zinnowitz
- Juli: Vom Fischereischuppen zum Klubhaus - ein Zeugnis der DDR-Erholungskultur am Specker Hofsee
- Juni: Das Tor zum Paradies – Die Restaurierung der Jugendstilkirche Lebbin
- Mai: Die Richtfunkfeuerstation in Mukran – eine Infrastrukturmaßnahme der frühen DDR an der Ostseeküste
- April: Es klapperte einst eine Mühle am rauschenden Bach – In die Wassermühle Roidin zieht neues Leben ein.
- März: Potentiale erkennen – Synergien nutzen. Fünf Jahre Zusammenarbeit mit der Hochschule Neubrandenburg
- Februar: Das Gutshaus in Lüssow. Die Nutzungsgeschichte und eine kunsthistorische Einordnung.
- Januar: Die Fachwerkstadt Parchim
2021 - Denkmale des Monats
- Dezember: Betonplatten und ihre Geschichte - das DDR-Grenzregime an der Ostsee
- November: Die Wandmalereien von Johannes Friedrich Sass in der Kapelle Stretense
- Oktober: Herzog Carl II. baut preisbewusst in Hohenzieritz
- September: "In des Goldes Scheine wie leuchtest du schön!" Die Siegessäule auf dem Alten Garten in Schwerin
- August: Sehen und Gesehen-Werden - auf den Standort des Betrachters kommt es an
- Juli: Von Fischern, Bauern und Büdnern – Die Büdnerei 165/166 in Wustrow auf dem Fischland
- Juni: Die Dorfkirche Buchholz in der Mecklenburgischen Seenplatte – ein bau- und kunsthistorisches Kleinod in mehrfacher Hinsicht
- Mai: Lehrerbildung und Blindenfürsorge in Neukloster. Ein neugotisches Baudenkmal
- April: Der deutsch-deutsche Archimedes – von Berlin über Würzburg nach Güstrow
- März: Die Blutbuche - Gartenkunst im Zeichen des Klimawandels
- Februar: Eine Vision wird Realität. Die Kulturkirche St. Jakobi in Stralsund hat wieder eine Orgel
- Januar: Der Architekt Paul Bonatz und das Getreidesilo im Rostocker Hafen von 1935. Ein Vorratsbau für den Krieg zwischen Monumentalität und Heimatstil
2020 - Denkmale des Monats
- Dezember: Die Karl-Krull-Grundschule in Steinhagen. Ein Schulbau auf dem Land der etwas anderen Art.
- November: Die Stubnitz-Lichtspiele in Sassnitz
- Oktober: Sie sind wieder da! Der Teepavillon des Schweriner Schlosses hat seinen Skulpturenschmuck zurückerhalten
- September: Die Villa der Gräfin von Schwicheldt - ein Frühwerk von Paul Ludwig Troost in Schwerin
- August: Noch ein vergessener Engel kehrt zurück. Der Taufengel der Kirche in Zahrensdorf
- Juli: "Ein Held [...] im Dienste seiner Kunst" - Das Grabdenkmal für Otto Drewes auf dem Alten Friedhof in Schwerin
- Juni: Verwunschener Gedächtnisort im Karower Gutswald - das Schlutius-Mausoleum
- Mai: Die gotische Kapelle Sankt Georg in Neubrandenburg - Instandsetzung der barocken Dachüberformung
- April: Der Kulturpark in Neubrandenburg - Zeugnis der Nachkriegsmoderne und heutiger Freizeitort
- März: Die Poetisierung der Landschaft - ein ungewöhnliches Wandbild von 1982 sucht einen neuen Standort in Schwerin
- Februar: Vorgestellt. Das Gutshaus in Wolkow bei Demmin.
- Januar: "Gestorben wird immer" - die Trauerhalle auf dem Waldfriedhof in Schwerin
2019 - Denkmale des Monats
- Dezember: Dorfkirche Bütow, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte - Die erste nachreformatorische Fachwerkkirche Mecklenburg-Vorpommerns
- November: Der Alte Hafen in Wismar im Wandel der Zeit
- Oktober: Die Restaurierung der Wandmalereien von Willi Schomann im Chor der St.Marienkirche Parchim
- September: Ein Giebelhaus in Parchim - Das Haus Lindenstraße 6 bekommt eine neue Nutzung
- August: "Kubische Klarheit" zwischen historischen Giebelhäusern: Das Bankgebäude von Hans Poelzig in Wolgast - schon vor der Erbauung ein Fall für die Denkmalpflege
- Juli: Der Pultengel aus der Dorfkirche Lüssow
- Juni: Eine Zierde für die Residenz - Anmerkungen zur Geschichte der Kirche in Görslow
- Mai: Klassenfahrten und ein Hauch von Exotik in Dreilützow
- April: Die Instandsetzung des Kirchturmes von Sankt Petri in Altentreptow
- März: Zinzow und Wrechen, zwei Gutsparks von Anders Swensson, einem schwedischen Gartenkünstler in Mecklenburg und Vorpommern
- Februar: Die Jahn-Kapelle in Klein Vielen und die Ästhetik des rückwärtsgewandten Bauens im 19. Jahrhundert
- Januar: Obermützkow. Ein barockes Gutstor und ein authentisch erhaltener Gutshof mit Potential.
2018 - Denkmale des Monats
- Dezember: Nachruf auf ein Kleinod moderner Architektur. Das Söderblom-Haus in Sassnitz - ein Werk von Otto Bartning im Notkirchenprogramm - wurde Opfer der Flammen
- November: Die Wohnsiedlung Riemserort. Eine Kleinhaussiedlung der Nachkriegszeit.
- Oktober: Mittelalterliche Wandmalereien an den Chorgewölben in der Dorfkirche Stoltenhagen
- September: Das Fischerhaus im Tollensesee
- August: Raus an die frische Luft! Das ehem. Kaiser-Wilhelm-Kinderheim in Ahlbeck – heute Ferienpark der Sportjugend Berlin
- Juli: Von Schollen, Blasen, Krakelee - Die Restaurierung des Marienaltars in der Kirche in Recknitz
- Juni: Gotische Kirche am Wasser. Die Schweriner St. Paulskirche als romantisch-programmatisches Symbol
- Mai: Neue Erkenntnisse zur Schmiedestraße 15 in Schwerin
- April: Gutshaus Pinnow, die Zweite.
- März: Von hohen Mauern umgeben – das Untersuchungsgefängnis in Wismar von 1880
- Februar: Ein neues althergebrachtes Farbspiel - die Restaurierung der Uferkapelle in Vitt auf Rügen
- Januar: Das Gutshaus und der Marstall in Broock - ein Werk Friedrich August Stülers in Vorpommern
2017 - Denkmale des Monats
- Dezember: Denkmal in Gefahr: Das Sauerstoffwerk in Peenemünde
- November: Ein Dach über dem Kopf - Behelfsheime für Evakuierte und Ausgebombte im Zweiten Weltkrieg
- Oktober: Der vergessene Engel - Der Taufengel von Stolzenburg und seine Restaurierung
- September: Gleviner Straße 1 in Güstrow - ein Beispiel der gehobenen Bürgerhausausstattungen der ehem. Residenzstadt
- August: Die mittelalterliche Gerichtsvorhalle im Turm der St. Marienkirche in Greifswald
- Juli: Gefangen im Denkmal. Die Sanierung des Sterngebäudes der JVA Bützow-Dreibergen.
- Juni: Der weibliche Wagner - Ein Relief gibt Rätsel auf
- Mai: Die Kultstätte der Neutempler bei Prerow
- April: Aus dem Dornröschenschlaf erweckt - das Gutshaus in Wolkwitz
- März: Zwei Seiten einer Medaille - Die Wiekhäuser der mittelalterlichen Stadtbefestigung in Neubrandenburg und der moderne Städtebau der DDR
- Februar: Auf dem "Scharmützel" - die Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit in Ferdinandshof
- Januar: Die „Alte Kirchenbude“ in Grimmen, eine ehemalige Sozialeinrichtung für Ledige und Witwen
2016 - Denkmale des Monats
- Dezember: Das Haus Karusel in Vitte, ein Sommerhaus von Max Taut auf Hiddensee
- November: In vorderster Reihe - Das Warnemünder Seemannshaus Am Strom 48
- Oktober: Altar und Stiftertafel - Der Altar der Klosterkirche Rühn und seine wiederholte Restaurierung
- September: Sonderlösungen der Fachwerksanierung ? - ein Beispiel zur Anwendung von Normen aus der Praxis
- Juli: Ein wilder Stier im Garten - Die Skulptur "Herakles, den kretischen Stier bändigend" im Schweriner Burggarten
- Juni: Revitalisierung einer historischen Seniorenanlage. Das ehemalige Spital in Penkun.
- Mai: Das Herrenhaus in Kaarz
- April: Der hölzerne Kirchturm von St. Marien in Neu Boltenhagen - ältester Holzständerturm Deutschlands entdeckt
- März: Leuchtendes Betonglas und die "Kirche im Sozialismus". Das Gemeindezentrum in Stralsund Knieper West von Christof Grüger und Ulrich Müther, 1975-1977
- Februar: Die Grotte im Park von Gützkow
- Januar: Gut überdeckt – die Dorfkirche Jördenstorf
2015 - Denkmale des Monats
- Dezember: "Licht und Schatten" - Die Gutshäuser in Varchentin, Rossewitz und Falkenhagen - 25 Jahre nach der Wende.
- November: Die Kreideverladebrücke in Wiek auf Rügen
- Oktober: Das versteckte Denkmal - eine Neuentdeckung in Meiersberg
- September: Französische Handdrucktapeten im Welterbebesucherzentrum der Hansestadt Wismar
- August: Der Papenhof in Barth
- Juli: Die Sanierung der Querhausportale der St. Marienkirche in Rostock
- Juni: Das kulturhistorische Zentrum Mecklenburg-Strelitz
- Mai: Die historischen Gewächshäuser der Universität Greifswald – ein national bedeutendes Kleinod der Wissenschaft und Lehre
- April: Vom Scheunenviertel zum Wohngebiet gehobener Mittelschichten – Die westliche Paulsstadt in Schwerin
- März: Ein Bild von Heimat und Nation. Die Lange Straße in Rostock (1953-1958)
- Februar: Neues Dach auf altem Schloss - Dachsanierung am Schloss Kummerow
- Januar: Das Altarretabel der Pfarrkirche St. Marien in Güstrow
2014 - Denkmale des Monats
- Dezember: Die Außenrestaurierung der ehemaligen Gutskirche zu Rothenklempenow im Landkreis Vorpommern-Greifswald
- November: Wismar, Frische Grube 5 – ein "Reihenhaus" von 1394
- Oktober: Das ehemalige Rittergut in Streu und seine jüngere Geschichte
- September: Familienheim und "Showroom" - Die Villa Korff in Laage
- August: Die Rebarockisierung des Gutshauses in Dubkevitz auf Rügen
- Juli: Das Welterbe-Besucherzentrum der Hansestadt Wismar
- Juni: Stein des Anstoßes?! Das "unbequeme" sowjetische Ehrenmal am Neuen Markt in der Hansestadt Stralsund
- Mai: Ein ererbtes bauliches Kleinod mit mehr als 650 Jahre Geschichte - Der "Weinberg" in Wismar
- April: Ein Tempel für den Sport - Die Neptun-Schwimmhalle in Rostock
- März: Das Borwinmonument im Güstrower Dom, Lkr. Rostock
- Februar: Die Dorfkirche von Cammin, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte
- Januar: Fachwerk, Farben und Feuerschutz – Grabow: ein Kunstwerk des barocken Städtebaus
2013 - Denkmale des Monats
- Dezember: Fast aufgegeben und doch gerettet – die ehemalige Synagoge in Stavenhagen
- November: Johann Albrecht und sein Stil – Terrakottaarchitektur des 19. Jahrhunderts in Schwerin
- Oktober: Die Schäferszenen – Ein gemaltes Kleinod im Schloss Mirow und dessen Restaurierung
- September: Die Dorfkirche von Melkof im Spiegel ihrer Instandsetzung und Restaurierung
- August: Jagdschloss Granitz, Rittersaal
- Juli: Schlossanlage Ivenack im Fokus
- Juni: Hoffnungsvolle Perspektive für das Kulturhaus im einstigen sozialistischen Musterdorf Mestlin
- Mai: Der heilige Georg und sein Martyrium – Eine Wandmalerei des 14. Jahrhunderts in der Kirche St. Nikolai zu Stralsund
- April: Das Kraftwerk Peenemünde – ein Denkmal und Museum von internationalem Rang
- März: Alt mit Neu: Die Kirchenausstattung in Nieden von Bruno Taut und Franz Mutzenbecher
- Februar: Thälmann ohne Mauer? Die künstlerische Idee des Ernst-Thälmann-Denkmals in der Hansestadt Stralsund
- Januar: Zum Schutze vor Revolten – Die Gendarmeriekaserne in Schwerin
2012 - Denkmale des Monats
- Dezember: Die Dorfanlage Alt Rehse - eine gebaute Idylle aus der Zeit des Nationalsozialismus
- November: Hansestadt Rostock, Beim Hornschen Hof 6
- Oktober: Das Gutshaus in Pinnow
- September: Weisdin – ein Herrenhaus, würdig eines Herzogs
- August: Die Dorfkirche von Siedenbollenthin, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte
- Juli: Ein wieder entdecktes mittelalterliches Tafelbild in der Rostocker St. Marienkirche
- Juni: Mecklenburg-Strelitzer Parkjuwel strahlt wieder - Der Schlosspark von Hohenzieritz
- Mai: Die ehemalige Landesirrenanstalt Domjüch bei Strelitz-Alt
- April: Die Restaurierung des Apostelfrieses an der Rostocker Marienkirche
- März: Das besondere Feriendomizil: Die mustergültige Umnutzung eines Wasserturms in Waren (Müritz)
- Februar: Der Kampische Hof - klösterliches Erbe in der Hansestadt Stralsund
- Januar: Blockhaus Vollendorf in Eichhof, Landkreis Vorpommern-Greifswald
2011 - Denkmale des Monats
- Dezember: Ein Kleinod der Stadtbaukunst - Der Alte Garten in Schwerin
- November: Lernen und Lehren im Kloster. Seit zehn Jahren belebt die Hochschule für Musik und Theater die Altstadt von Rostock
- Oktober: Schwerin, Schelfmarkt 1
- September: Was wird aus dem Gutshaus in Sommerfeld?
- August: Bäuerliche Baukunst vor den Toren Schwerins - Das Hallenhaus Zu den Eichen 7 in Pampow
- Juli: Reparatur einer zerstörten Stadtsilhouette - Wiederaufrichtung des Daches der Nikolaikirche in Anklam
- Mai: Der Totentanz in der St. Petrikirche zu Wolgast
- April: ... Was wäre das Schloss Schwerin ohne den (Burg-) Garten und die Parklandschaft?
- März: Der herzogliche Theatersaal am Rostocker Universitätsplatz
- Februar: Das Grabmal der Herzogin Dorothea von Dänemark im Dom zu Güstrow
- Januar: Der Sassnitzer Stadthafen
2010 - Denkmale des Monats
- Dezember: Man muss schon genau hinschauen! Ein Plädoyer für die Bauforschung am Beispiel des sogenannten Pförtnerhauses in Bergen auf Rügen, Billrothstraße 20
- November: Sommerfrische auf Hiddensee - Das Ferienhaus von Eckart Muthesius in Kloster
- Oktober: So ein Theater … Das Mecklenburgische Staatstheater – ein bedeutendes Baudenkmal
- September: Ab die Post? Die verspätete Moderne in der DDR und das bauliche Erbe
- August: Beherzt angepackt – Die Turmdachsanierung der Kirche St. Marien zu Rostock
- Juli: In letzter Minute gerettet: Zeugen renaissancezeitlicher Wohnkultur in Rostock
- Juni: Eine bedeutende Gutsanlage in Feldsteinbauweise
- Mai: Angenommene Geschichte: die Sanierung des Gutshauses von Mölln, Landkreis Demmin
- April: Der Denkmalbereich Gartenstraße in Rostock-Warnemünde
- März: Großartige barocke Schnitzkunst – Der Taufbaldachin von St. Nikolai in Stralsund
- Februar: Reizvolles bau- und gartenkünstlerisches Ensemble: Die Parkanlage Hasenwinkel
- Januar: Mittelalterliche Entstehung noch deutlich zu erkennen: das Rathaus von Grimmen
2009 - Denkmale des Monats
- Dezember: Die Kirche St. Katharinen zu Stralsund - Ältestes Hallendachwerk Deutschlands über dem Meeresmuseum entdeckt
- November: Gedenken mit sakralen Mitteln – Die Gedenkstätte an der Chausseestraße in Löcknitz
- Oktober: Eine Besonderheit in St. Jakobi zu Stralsund: Der Bunte Pfeiler
- August: Lebendiges Industriedenkmal: die Forstsamendarre von Jatznick
- Juli: Ein Relikt aus der Zeit der Zisterzienser: die ehemalige Klosterscheune in Greifswald-Eldena
- Juni: Das ehemalige Lehrerseminar in Franzburg - Etappen wechselvoller Nutzung
- Mai: Die Muna Strelitz
- April: Die Fachwerkkirche zu Hildebrandshagen in Mecklenburg-Strelitz
- März: Franzburg: ein ehemaliges Wirtschaftsgebäude?
- Februar: Eine Herrenhausruine und ein Landschaftspark in Pansevitz auf Rügen
- Januar: Wechselvolle Geschichte: Schloss Ludwigsburg, Lkr. Ostvorpommern
2008 - Denkmale des Monats
- Dezember: Das Orgelpositiv von Schloss Griebenow
- November: Das Flächendenkmal Peenemünde
- Oktober: Das Haus der Kultur und Bildung in Neubrandenburg
- September: Vorhaben: Abbruch. Vom Adelspalais zur Mogelpackung? – Das Haus Grunthalplatz 1–2/Wismarsche Straße 170 in Schwerin
- August: Barockes Kleinod: der Orgelprospekt in der Kirche von Serrahn, Lkr. Güstrow
- Juli: Das ehemalige Amtsgericht von Malchow
- Juni: Eine ursprünglich gewollte Einheit: bischöfliche Grabplatten im Dom zu Schwerin
- Mai: Die Klosterkirche in Verchen und ihre Wandmalereien
- April: Einfach abreißen? Abgesang auf ein Kino - die Schauburg in Schwerin
- März: Das Standbild des großen Kurfürsten in Putbus auf Rügen
- Februar: Die Rollklappbrücke in Anklam
- Januar: Ein Relikt des 18. Jahrhunderts: Das Wohnhaus in der Grünstraße 17 in Pasewalk, Lkr. Uecker-Randow
2007 - Denkmale des Monats
- Dezember: Die Stadt Güstrow
- November: 150-jähriges Bestehen des Burggartens auf der Schlossinsel Schwerin
- Oktober: Loitz, Landkreis Demmin: Umnutzung eines Bahnhofempfangsgebäudes mit Güterboden zu einer Gaststätte und zwei Wohnungen
- September: Wechselvolle Geschichte: der Hauptaltar aus der Kirche St. Georgen in Wismar
- August: Fachwerk aus dem 16. Jahrhundert in der Schweriner Puschkinstraße 36
- Juli: Das Fürstenepitaph im Doberaner Münster
- Juni: Düssin, Gutsanlage, großes Viehhaus (Kuhstall)
- April: Güstrow, Lange Straße 41, Stadtpalais